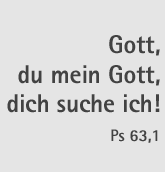Zum benediktinischen Gelübde der stabilitas
Die Weite in der Grenze
Zum markanten, über die Grenzen des Ordens bewussten Eigengut benediktinischen Selbstverständnisses gehört das Gelübde der stabilitas. Im 58. Kapitel seiner Regel[1] formuliert Benedikt ohne jeden Zusatz „promittat de stabilitate – verspreche er Beständigkeit“ (Vers 17). Im gängigen Außenverständnis wird uns Benediktinern eine „stabilitas loci - eine Ortsbeständigkeit“ zugesprochen[2], die oftmals noch weiter dahin verkürzt wird, dass der Benediktiner eigentlich nie sein Kloster verlassen dürfe. So viel Richtiges in dem Kurzwort Ortsbeständigkeit angesprochen sein mag und ist, so sehr sollte sich der Leser der Regel und des benediktinischen Lebens bewusst sein, dass die „stabilitas loci“ als Begriff nicht in der Regel auftaucht.
Die Interpretation des Gelübdes der „stabilitas“ innerhalb des Ordens zielt durchwegs auf eine Beziehung zu einer konkreten Gemeinschaft und erst mittels dieser Gemeinschaft auf einen konkreten Ort. Die Regel selbst legt diese Verbindung in Kapitel 4,78 nahe. Die Werkstatt, in der „Die Werkzeuge der geistlichen Kunst“ – so die Kapitelüberschrift – gehandhabt werden, sind die „claustra monasterii et stabilitas in congregatione – der Bereich des Klosters und die Beständigkeit in der Gemeinschaft.“ Die Rechtsregelungen der Kongregation von Subiaco formulieren: „Durch das Gelübde der Stabilität bindet sich der Mönch an das Kloster seiner Profeß, er verbindet sich mit der dort lebenden monastischen Familie und verspricht, sich niemals dem Joch der Regel zu entziehen“ (OCG 59). Ein wenig salopp formuliert: Der „Eintritt in ein Kloster“ spricht nicht davon, dass jemand ein Gebäude betritt, sondern davon, dass eine personale Beziehung aufgenommen wird, die nach dem Willen beider Seiten von Dauer sein soll.
„promittat stabilitatem – er verspreche Beständigkeit“
Ein Versprechen der „stabilitas“ taucht im eingangs genannten Kapitel 58 der Benediktregel noch einmal auf. Gleich zu Beginn seines klösterlichen Weges wird es dem Eintretenden abverlangt. Der Eintrittswillige hatte beharrlich an der Klosterpforte angeklopft, man hatte ihn in den Gastbereich aufgenommen, dann in die Novizenwohnung. Der Eintritt war ihm nicht leicht gewährt worden (Vers 3f), das Harte und Rauhe des klösterlichen Lebensweges war ihm nicht verschwiegen worden (Vers 8). Dann heißt es: „Si promiserit de stabilitatis suae perseverantia ... – Wenn er verspricht, beharrlich bei seiner Beständigkeit zu bleiben, lese man ihm nach Ablauf von zwei Monaten diese Regel von Anfang bis Ende (= per ordinem[3]) vor“ (Vers 9). Wenn ich es recht sehe, dann ist dieses Versprechen nach (etwa) zwei Monaten abzulegen[4]. Der zitierte Vers bringt „stabilitas – Beständigkeit“ und „perseverantia – Beharrlichkeit“ miteinander in Verbindung. Im Lateinischen ist die „stabilitas“ als Genitiv-Form der „perseverantia“ untergeordnet; die Übersetzung versucht, das – ein wenig holprig – mit „beharrlich bei seiner Beständigkeit zu bleiben“ zu übersetzen. Frei würde ich persönlich paraphrasien: „Will der Neue auch nach der ersten theoretischen Einführung in die Herbheiten des klösterlichen Lebens und nach der konkret-unmittelbaren Erfahrung mit diesen Herbheiten noch bleiben, dann lese man ihm diese Regel von Anfang bis Ende vor.“
Das Vorlesen der Regel fordert offenbar noch einmal anders und tiefer die Frage nach dem Weitermachen heraus. Vers 11 des Kapitels beginnt: „Si adhuc steterit ... – Wenn er immer noch bleiben will ...“. Nach sechs Monaten wird dem Novizen wieder die Regel vorgelesen und wiederum fährt Benedikt fort: „Et si adhuc stat ... – Wenn er noch bei seinem Entschluss bleibt ...“ (Vers 13). Das Wort „stabilitas“ verwendet Benedikt in den beiden letzten Zitaten nicht. Aber das Wort ist nicht fern, denn das Verb „stare – stehen“ ist – leicht erkenntlich – Wurzelgrund des Substantivs „stabilitas“.
Einige Elemente aus diesem ersten Blick in die Regel sollen hervorgehoben werden:
„Stabilitas“ wird in Verbindung gebracht mit den Herbheiten und Härten, die im klösterlichen Leben nicht ausbleiben. „Stabilitas“ ist keine Schönwetter-Tugend, sondern offenbart sich im Sturmgeschehen.
„Stabilitas“ mag eine im Mönchsinteressenten angelegte (Vor-) Gabe sein, aber sie ist nicht mit einem Schlag und unverbrüchlich da, sondern sie ist durch die Lebensrealität im Kloster – und überhaupt - auf die Probe gestellt. Der tatsächlichen Wirklichkeit muss sich der Neuling stellen. Die Klostergemeinschaft darf sich und das Klosterleben nicht „schön färben“. Der Novize muss zum realen – nicht zum idealen! - Klosterleben „Ja“ sagen.
In den zeitlichen Intervallen der Regelvorlesung, wie sie das 58. Kapitel der Regel für den Novizen vorsieht, deutet sich an, dass der „fervor novicius – der Eifer des Anfängers“ (RB 1,3) schrittweise über sich herauswachsen muss, um tragend für das Leben sein zu können. Ohne Anfangsbegeisterung wird es kaum einen Anfang geben. Aber die Grenze der Anfangsbegeisterung ist und bleibt der Anfang; weiter führt sie nicht.
„Stabilitas“ ist kein punktuelles Versprechen, das auf ein für alle mal auf einer fixen Höhe steht, sondern ein Wachstumsprozess und Bereitschaft zum Wachstum. „Stabilitas“ ist in diesem Sinn eine Weg-Tugend.
„Stabilitas“ kann darum nie als ein Sich-zur-Ruhe-Setzen verstanden werden. Wer sich etabliert hat, um das deutsche Lehnwort zu „stabilitas“ hier einzubringen, beweist nicht „stabilitas“, sondern ist festgefahren. Er steht im Glaubens- und Lebensprozess auf wackligen Füßen, - ist also alles andere als stabil.
„semper vagi et numquam stabiles – immer unterwegs, nie beständig“ (RB 1,11)
Im Kapitel 1 der Regel schildert Benedikt vier Arten von Mönchen, von denen er zwei ablehnt. Die vierte Sorte ist ihm besonders verabscheuungswürdig. Bei ihrer Beschreibung taucht das Wort von der „stabilitas“ erstmals in der Regel auf. Benedikt beschreibt diese Mönchsart: „Die vierte Art der Mönche sind die sogenannten Gyrovagen. Ihr Leben lang ziehen sie landauf landab und lassen sich für drei oder vier Tage in verschiedenen Klöstern beherbergen. Immer unterwegs, nie beständig, sind sie Sklaven der Launen ihres Eigenwillens und der Gelüste ihres Gaumens. In allem sind sie noch schlimmer als die Sarabaiten“ (RB 1,10f).
Die gerade genannten Sarabaiten waren die dritte von Benedikt genannte Mönchsart. Der kritische Rückverweis Benedikts auf diese Sarabaiten lädt ein, Benedikts Bemerkungen zu ihnen sich ebenfalls vor Augen zu stellen: „Weder durch eine Regel noch in der Schule der Erfahrung wie Gold im Schmelzofen erprobt, sind sie weich wie Blei. In ihren Werken halten sie der Welt immer noch die Treue. Man sieht, dass sie durch ihre Tonsur Gott belügen. Zu zweit oder zu dritt oder auch einzeln, ohne Hirten, sind sie nicht in den Hürden des Herrn, sondern in ihren eigenen eingeschlossen; Gesetz ist ihnen, was ihnen behagt und wonach sie verlangen. Was sie meinen und wünschen, das nennen sie heilig, was sie nicht wollen, das halten sie für unerlaubt“ (RB 1,6-9)
Sarabaiten und Gyrovagen werden von Benedikt als Negativfolie durchgezeichnet, aus der sich sein eigenes Mönchsverständnis als Kontrastprogramm erkennen lässt. Die „stabilitas“ ist in diesem Zusammenhang ein wichtiger Programmpunkt, - gewissermaßen eine Schlüssel-Tugend. Im unmittelbar griffigen Textverstehen ist die „in-stabilitas“ der Gyrovagen offensichtlich ein durchaus geographisches Herumstreunen. Die Gyrovagen „klostern“ sich von einem zum nächsten Kloster. Sie sind ruhelose Mönchsvaganten oder gar -vagabunden („semper vagi“).
Das äußere Vagantentum dieser Mönchsart ist für Benedikt Äußerung einer inneren Haltung. Sie sind ich-verhaftete Weichlinge - „eingeschlossen in die eigenen Hürden“, „weich wie Blei“ -, die sich das Mönchtum nach eigenen Gusto zurecht biegen. Sie sind zwar zur Grüppchenbildung – „... zu zweit oder zu dritt ...“ – fähig, aber nicht eingliederungswillig/fähig in eine Gemeinschaft und nicht gewillt, sich an einen und unter einem „Hirten“ zu binden. Sie sind nicht ein-sichtig, sondern auf ihr Aus- und An-sehen bedacht. Spitz formuliert: Sie sind in Benedikts Augen Tonsur-süchtig und Pseudomönche. „Man sieht[5], dass sie durch ihre Tonsur Gott belügen.“ Image und Verpackung sind ihnen wichtiger als der Gehalt.
Bewährungsscheu und erprobungsflüchtig verfransen sich Sarabaiten und Gyrovagen im vagen Traum eines idealen Mönchtum und verweigern sich der griffigen Konkretion der Wirklichkeit. Sie sind Menschen ohne „Pack-an“, - ohne Profil, - ohne Angreifbarkeit und Griffigkeit. Sie sind momentanistisch, - ohne den Mut zur Vergangenheitsverantwortung und ohne wirkliche Zukunftssehnsucht. Sie sind Menschen voller Nebel und Traumtänzerei, aber mit schwachem Willen und Durchhaltevermögen.
„stabilire potest abbas – der Abt kann zuweisen“ (RB 61,12)
Benedikt kennt bzw. nennt zwei legitime Situationen, die - zumindest beim ersten Hinsehen – dem Stabilitätsgedanken zu widersprechen scheinen: den Wechsel vom könobitischen Mönchtum in die eremitische Berufung (RB 1,3 - 5) und die Aufnahme eines Mönches, der einem anderen Kloster zugehört (RB 61,5 – 14). Beide Regelabschnitte verdienen wegen dieser Widersprüchlichkeit ein zweites, genaueres Hinsehen. Als verwandt gelagerte Situation ist auch der Eintritt von Priestern und Klerikern in den Blick zu nehmen (RB 60).
Gemeinsam ist allen drei Situationen, dass Benedikt sich gegenüber den entsprechenden Ansinnen sehr vorsichtig verhält. Vielleicht steht dahinter die Erkenntnis, dass der Schritt in die jeweils neue Existenz so einschneidend ist, dass man besser dreimal hinschaut, als dass man vor lauter Begeisterung „aus dem Häuschen“ fährt. Benedikts Zurückhaltung gegenüber diesen Wechselwünschen ist eine Vertiefung seiner grundsätzlichen Vorsicht bei Eintrittswünschen. „Kommt einer neu und will das klösterliche Leben beginnen, werde ihm der Eintritt nicht leicht gewährt, sondern man richte sich nach dem Wort des Apostels: ‚Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind’“ (RB 58,1f).
Entscheidend ist vor allem die klösterliche Alltagstauglichkeit, die ich als die kleine Münze der großen Währung „stabilitas“ bezeichnen möchte. Der künftige Eremit ist durch die Schule der „monasterii probatio diuturna – der Bewährung im klösterlichen Alltag“ gegangen (RB 1,3). Der Bitte des Priesters „non quidem citius adsentiatur – stimme man nicht gleich / vorschnell zu“ (RB 60,1). Der Mönch aus dem anderen Kloster, der als Gast längere Zeit da ist, zeigt in dieser Zeit seine „vita – Lebensführung“ (RB 61,3), die im Guten wie im Schlechten das aussagekräftigste Zeugnis seiner Tauglichkeit für diese Gemeinschaft ist.
Es fällt auf, dass – wie bei der Aufnahme eines Novizen (RB 58) – auch bei den hier betrachteten Wechseln der Lebenssituation der Abt weit in den Hintergrund tritt. Der zukünftige Eremit ist „durch die Hilfe vieler hinreichend geschult“ (RB 1,4). In den Kapiteln 60 und 61 dominieren die Passiv-Formen der Verben: „man“ reagiert auf die Übertrittswünsche des Klerikers bzw. des fremden Mönches. Es liegt nahe, darin das Gewicht einer solchen Entscheidung auch für den betroffenen Konvent zu erkennen. Der Abt soll offensichtlich nicht über die Köpfe seiner Gemeinschaft hinweg auf die Wünsche der Eintritts-/Übertrittswilligen entscheiden. Unmittelbar aktiv wird der Abt erst bei der Einordnung der Übertretenden in die Präzendenz der Mitbrüder. „Hat der Abt einen solchen Mönch als vorbildlich erkannt, darf er ihm einen etwas höheren Platz zuweisen. Kommt der Abt bei Priestern und Klerikern, wie schon gesagt wurde, zu einem ähnlichen Urteil, darf er nicht nur einen Mönch, sondern auch sie an einen höheren Platz stellen („stabilire potest abbas in maiori ... loco“), als es ihrem Eintritt entspricht“ (RB 61,11,f).
Die Legitimation für die Aufgabe einer bisherigen „stabilitas“ zugunsten einer neuen scheint mir bei Benedikt zu sein, dass die alte zu einer gewissen Fülle gekommen ist. Der Wechsel ist weder ein Happening, mal etwas anderes versuchen zu wollen, noch das Scheitern des bisherigen Lebenskontextes und damit eine Krise, sondern er vollzieht sich auf einer soliden Grundlage einer erreichten und er-lebten „stabilitas“. Wenn der Mönch aus dem anderen Kloster in Benedikts Kloster „voluerit stabilitatem suam firmare – sich zur Beständigkeit verpflichten will“ (RB 61,5), dann beginnt er nicht mit etwas ganz Neuem an einem Nullpunkt, sondern hat einen erkennbaren Stabilitätsweg hinter sich. Der Wechsel vollzieht sich nicht aus einem Katastrophenszenario, sondern als evolutiver Schritt aus einem gelungenen Lebensabschnitt in eine neue Höhe, Tiefe, Weite – oder wie auch immer man das nennen mag.
„maturitas non sinit vagari – der Reife treibt sich nicht herum“ (RB 66,1)
Die Schwellensituation zwischen draußen und drinnen, zwischen Welt und Kloster ist eine besonders gefährdete und gefährdende. Aus den verschiedensten Gründen muss sie schlicht und einfach zuverlässig im Auge behalten werden. Die Anklopfenden „semper praesentem inveniant – sollen immer einen antreffen ...“ (RB 66,2). Sicher ist das „immer“ betont, aber genauso sicher darf man wohl all das mitschwingen hören, was uns Heutigen mit dem Lehnwort „präsent“ mitklingt. Der Pförtner muss nicht nur irgendwie äußerlich anwesend sein, sondern er muss auch wirklich „da sein“, - er muss seiner Aufgabe gewachsen sein, - er muss wach sein für die jeweilige Herausforderung, die von außen an ihn herankommt. Mit dem Prior und dem Cellerar gehört er zu den herausragenden Offizialen des Klosters, denen ein eigenes Regelkapitel gewidmet ist.
Während die Gyrovagen von Kapitel 1 als „semper vagi“ charakterisiert werden, heißt es vom guten Pförtner, dass er „semper praesens“ ist. Er ist kein „vagus – Herumtreiber“ . Vielleicht darf man auch ein wenig großzügig ausmalen: Der gute Pförtner ist kein umtriebiger Geschaftlhuber, der überall etwas zu tun, zu sehen, zu reden findet, - nur nicht dort, wo sein eigentlicher Platz ist. Und sicher ist er nicht der Gerüchtesammler und –trommler der Gemeinschaft, der zwischen Welt und Kloster herumtratscht. Er soll ein „senex sapiens“ sein, „cuius maturitas eum non sinat vagari - Seine Reife bewahrt ihn davor, sich herumzutreiben.“ Was ihn auszeichnet, sind „sapientia – Weisheit“ und „maturitas – Reife“.
Die mit der Regel Benedikts Vertrauten wissen, dass mit den Altersbegriffen „senior“ und „senex“ nicht einfach das physische Alter der so Charakterisierten gemeint ist. Die geistliche und menschliche Reife ist ganz stark in die Alterscharakterisierungen „senior“ und „senex“ eingeflossen. Auf der anderen Seite sollte man aber auch nicht so weit gehen zu sagen, dass das physische Alter für die „maturitas“ überhaupt keine Rolle spiele. Normalerweise dürfte das Gegenteil der Fall sein[6]. Die wachsende Zahl der Jahre schenkt mehr und mehr Erfahrung und damit – zumindest in der Theorie – einen Zuwachs an „maturitas“, an Gelassenheit und darin einen Zuwachs an „stabilitas“. Wenn das wenigstens ansatzweise stimmt, dann kann das Gelübde der „stabilitas“ bei Benedikt auf keinen Fall sich nur auf einen statisch umgrenzten, schematisch abfragbaren und einklagbaren Verhaltenskodex beziehen. Es kann eigentlich nur bedeuten zu versprechen, am Ball des inneren Wachstums bleiben zu wollen. Es ist weniger ein Versprechen, dieses und jenes zu tun und ein Drittes und Viertes zu lassen, als vielmehr das Bekenntnis einer unbändigen Sehnsucht, die die Grenzen des Hier und Jetzt auf Unendlichkeit hin aufbrechen will.
Neben dem „vagari – Herumtreiben“ dürfte die „acedia – die Unlust“[7] das Kontrastverhalten zur „stabilitas“ sein. Benedikt versucht, den Weg zur „stabilitas“ zu fördern, indem er für wichtige Bereiche des Lebens klare Regelungen vorgibt, z.B. für die Psalmenverteilung und das Offizium überhaupt, aber auch für die Verteilung von Arbeit, Gebet, Lesung und Erholung über den Tag hin. Das System einer solchen Ordnung ist eine Hilfe für die innere Ruhe, wobei ich diese Ruhe durchaus als eine Deutungsvariante der „stabilitas“ verstehe. Den Alltag jeden Tag neu zu finden oder gar erfinden zu müssen, ist beunruhigend und ein Virus der „in-stabilitas“.
Im 48. Regelkapitel „Die Ordnung für Handarbeit und Lesung“ spiegelt sich offensichtlich deutlich wieder, dass manuelle Arbeit, bei der griffig-sichtbare Ergebnisse rauskommen, seinen Mönchen weniger problematisch ist als die geistig-geistliche Mühe der Lesung[8]. Was „bringt es“ auch schon, zu lesen oder zu beten? Die Gefahr des großzügigen „Schlabberns“ in diesem Bereich ist sicher nur allzu menschlich. Benedikt bietet für diese Gefahr die Hilfe erfahrener Mitbrüder – „seniores“ – an. Benedikt spricht hier allerdings nicht von „Hilfen“. Er drückt sich entschieden drastischer aus. Im Hinblick auf Benedikts deutliche Sprache, sollten auch wir vor dieser Deutlichkeit nicht zurückscheuen: Benedikt lässt die Lesezeiten der Mitbrüder „kontrollieren“. „Vor allem aber bestimme man einen oder zwei Ältere, die zu den Stunden, da die Brüder für die Lesung frei sind, im Kloster umhergehen[9]. Sie müssen darauf achten, ob sich etwa ein träger Bruder („frater acediosus“) findet, der mit Müßiggang oder Geschwätz seine Zeit verschwendet, anstatt eifrig bei der Lesung zu sein; damit bringt einer nicht nur sich selbst um den Nutzen, sondern lenkt auch andere ab“ (RB 48,17f)[10].
Folgerungen
Das Verstehen von Benedikts Gedanken zur „stabilitas“ greift entschieden zu kurz, wenn man sie auf die Ortsbeständigkeit hin reduziert. Meines Erachtens greift auch die Deutung der „stabilitas“ als Beständigkeit in der brüderlichen Gemeinschaft dieses oder jenes Klosters zu kurz. Beides gehört zur „stabilitas“ dazu, aber sie erschöpft sich weder in der Ortsbeständigkeit noch in der Beständigkeit in der Gemeinschaft. „Stabilitas“ ist bei Benedikt ein umfassenderer Begriff, der das ganze menschliche und geistliche Leben in den Blick nimmt.
In unserer Lektüre des Begriffes sind uns die „maturitas – Reife“, die „sapientia – Weisheit“ und die „senes/seniores – ältere Brüder“ begegnet. Alle diese Begriffe suggerieren einen Wachstumsweg von bescheidenen, begrenzten Anfängen zu größerer und größerer Tiefe. Dieser Weg braucht auch schlicht und einfach Zeit. Auf dem Zeitweg des Wachsens in die „stabilitas“ wird es eine von Zeit zu Zeit unterschiedliche Dynamik geben. Es gibt die Zeiten, in denen es „recto cursu – schnell, geradewegs“ (RB 73,4) vorwärts geht, - es gibt die anderen Zeiten, wo es eher mühsam, „magis ac magis – Schrittchen für Schrittchen“ (RB 62,4) läuft. Wahrscheinlich ist das Letztere eher der normale Alltag des geistlichen Lebens. Die „seniores“ eines Klosters dürften die sein, die den positiven Wert der kleinen, aber stetigen Schritte internalisiert haben. Heiligkeit ist nicht mit Sieben-Meilen-Stiefeln zu erreichen.
Als ein das ganze Leben betreffender Begriff ist eine Eingrenzung des „stabilitas“-Gedankens auf einen rein asketischen oder spirituellen Bereich auch bei Benedikt nicht denkbar. Eine „fromme“ Engführung würde die Reifung der „stabilitas“ eher behindern als fördern. Für eine ganzheitliche Reifung sind in diesem Sinn sicher auch die Erkenntnisse der Psychologie und die Chancen ihrer Methoden zu berücksichtigen. Zwar kann auch die Psychologie keine Wunder wirken, aber eine generelle Skepsis gegen sie ist unangebracht.
In der von mir angedeuteten Verstehensweite lässt sich „stabilitas“ nicht rechtlich fassen. Benedikts Gelübdetrias ist keine Rechtsformel mit präzise erkennbaren Grenzen. Sie ist ein Zielhorizont, der mehr und mehr er-lebt werden will. Je weiter und länger der Weg der „stabilitas“ sich hinzieht, desto präziser wird er werden. Das heißt, er wird einerseits immer enger und damit profilschärfer, andererseits füllt er sich mit der Weite wachsender Gewissheit und Zufriedenheit[11].
Der gerade genannte Zielhorizont kann sicher noch näher umschrieben werden. In RB 58,7 wird den Verantwortlichen ans Herz gelegt, genau darauf zu schauen, „si revera deum quaerit – ob der Novize wirklich Gott sucht“. In dem „revera – wirklich“ erkenne ich die Frage nach der „stabilitas“ wieder. Es ist zu wenig, den Mönch zu spielen, und es reicht auch nicht, den Mönch zu träumen. Ernsthaftigkeit, langer Atem, sich selbst fordernde Zielstrebigkeit ist angesagt. Und das Ziel heißt Gott, - nur er und nichts weniger. Im Regelprolog wird der Weg zu ihm zunächst als ein Rückweg zum Ausgangspunkt des Menschen beschrieben (Prolog 2). Später wird mit Psalm 34 vom Leben gesprochen (Prolog 12 – 20), dann mit Psalm 15 vom Wohnen in Gottes Zelt auf seinem heiligen Berg (Prolog 22 – 28). Im Schlusskapitel der Regel wird die „patria caelestis – das himmlische Vaterland“ als Ziel genannt (RB 73,8).
Der Umschreibungen sind nicht wenige und es werden sicher noch viele weitere möglich sein[12]. Was mir in ihnen vor allem zur Sprache zu kommen scheint, ist die Sehnsucht, das Leben auf eine Mitte hin zu fokussieren und diese Mitte auf ihren Reichtum hin auszubuchstabieren. Benedikt hat für sich Gott als den Fokus seines Lebens entdeckt und ihn in seiner Regel anbuchstabiert.
Weiterungen
Benedikt hat seine Regel für Mönche geschrieben. Dabei wollte er keine neue Heilsbotschaft, kein neues Evangelium schreiben, sondern das Evangelium Jesu Christi in konkrete Handlungsoptionen übersetzen. Für Mönche geschrieben, haben viele Christen durch die Jahrhunderte erkannt, dass die Regel so tief aus der evangelischen Botschaft schöpft, dass sie auch für sie Richtlinien für das Gelingen christlichen Lebens außerhalb des Klosters geben kann[13].
Eine nicht mehr ganz neue, aber doch noch relativ junge Erkenntnis ist, dass die Mönchserfahrung Benedikts darüber hinaus eine nüchterne und solide Menschenkenntnis wiederspiegelt, die für modernstes Führungsmanagement fruchtbar gemacht werden kann. Diese Menschenkenntnis ist in seine Regel eingeflossen und das klösterliche Leben hat sie ihrerseits auch mitgeprägt, aber sie ist nicht auf die Klausurgrenzen begrenzt. Man kann getrost von den Etagen höherer Betriebsebenen hinuntersteigen und die Klausurmauern übersteigen, um im Kleinklein des privaten Lebens und seiner Tücken zu testen, ob und wie Benedikt Hinweise für „normale“ Lebensfestigkeit gibt[14].
Unter diesem Aspekt wäre es für den nicht-klösterlichen Leser vielleicht interessant oder sogar spannend, die hier vorgetragenen Gedanken noch einmal auf seinen eigenen Lebensbereich und Lebensstil hin zu lesen. Ich bin überzeugt, dass er manches bei Benedikt finden wird, das „wie im richtigen Leben“ ist.
Albert Altenähr OSB
2002-04-24
[1] Der Text der Regel ist zu finden unter: benediktiner.de.
[2] So auch bei Basilius Steidle, Die Benediktus-Regel. Lateinisch – Deutsch, Beuron, 1978, im „Sachverzeichnis zur Regel“, Stichwort „Profeß“: „örtl. Beständigkeit“.
[3] Vgl. RB 48,15, wo Benedikt für die Fastenzeit den Brüdern die Lektüre eines Buches der Heiligen Schrift „per ordinem ex integro“ vorschreibt. Das ist offensichtlich eine Zumutung und Herausforderung, - ein die „stabilitas“ stärkendes Training und zugleich ein Testfall.
[4] Georg Holzherr, Die Benediktsregel. Eine Anleitung zu christlichem Leben, Zürich – Einsiedeln – Köln, ²1982, 276, lässt offen, ob diese Regellesung am Beginn oder am Ende der zwei Monate vorgenommen wird. Er tendiert aber eindeutig dahin, die Lesung für den Beginn der zwei Monate anzusetzen.
[5] Ich möchte dieses „man sieht ...“ bewusst einmal stärker gewichten, als es wahrscheinlich von Benedikt gemeint war. Vom äußeren, mit dem Auge erkennbaren Gehabe schließt Benedikt auf das Innere. Wir Mönche – und bestimmt nicht nur wir – sollten uns sehr bewusst sein, dass wir uns – um es Neudeutsch zu sagen – schon längst „geoutet“ haben, bevor wir uns „outen“. Wer sehen kann, sieht sehr viel, - meist mehr. als der andere je und je zeigen will.
[6] Den Normalfall stellt Gregor der Große in seiner Vita Benedikts heraus, indem er bewundernd beim jungen Benedikt seine für sein Alter absolut untypische Reife erwähnt: „ Schon von früher Jugend an hatte er das Herz eines reifen Mannes (‚Ab ipso pueritioae suae tempore cor gerens senile’), war er doch in seiner Lebensweise seinem Alter weit voraus“ (Gregor d.Gr., Dialoge II,1).
[7] Das Glossar der lateinisch-deutschen Regelausgabe der SÄK deutet und übersetzt „acedia“ als „geistliche Trägheit, Unlust, Widerwille, Überdruss am religiös-asketischen Leben“ (S. 272).
[8] Vgl. o. Anm. 3.
[9] Interessant: um dem Umherstreunen zu wehren, müssen einige Ältere im Kloster umhergehen!
[10] Vgl. auch RB 43,8 die Mahnung, bei Verspätungen zum gemeinsamen Gebet nicht „großzügig“ ganz der Gebetszeit fern zu bleiben. Vgl. dazu Gregor d.Gr., Dialoge II,4. – Ich habe beim Schreiben dieser sicher delikaten Gedanken über die „Kontrolle“ des geistlichen Tuns durch andere noch einmal in den Abschnitt „Die Zucht als Lehrmeisterin in das Gebet“ meiner Dissertation über Bonhoeffer hineingeschaut. Bonhoeffers Erfahrungen und Hinweise lassen sich nahtlos in Benedikts Gedanken über die „stabilitas“ einfügen. Albert Altenähr, Dietrich Bonhoeffer – Lehrer des Gebets. Grundlagen für eine Theologie des Gebets bei Dietrich Bonhoeffer, Würzburg, 1976, 260 – 267.
[11] Vgl. RB Prolog 45 – 49.
[12] In besonderer Weise sei hingewiesen auf die kosmische Vision, die Gregor d.Gr. in seiner Vita Benedikts dem Heiligen zuschreibt (Dialoge II,35).
[13] Die Oblaten unserer Klöster sind da nur eine Gruppierung, die die Fruchtbarkeit der Benediktregel für ihre christliche Lebensgestaltung wahrnimmt und zu realisieren versucht.
[14] Aus meinem klösterlichen Lebensbereich wäre in solchem Kleinklein vielleicht einmal der „Verwandtschaft“ vom unkonzentrierten Herumzappeln beim Chorgebet, dem Herumzappen beim Fernsehen und dem Gyrovagentum nachzuspüren. Nach draußen hin könnte man einmal fragen / sich fragen lassen, wie es mit dem Herumzappen von Event zu Event, von Termin zu Termin steht, um ja nichts vom Leben zu verpassen. ... und unter Umständen hat man vor all dem vielen Angebotenen schließlich nur „Nichts“ vom Leben mitbekommen.